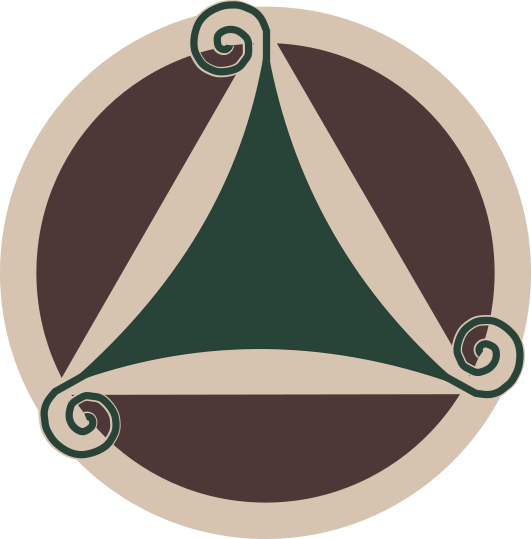Die „Germanen“: Vom Mythos zur Moderne
Diese Übersicht erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und dient lediglich einem ersten Eindruck. Entsprechend sind einige Aspekte für eine bessere Lesbarkeit vereinfacht dargestellt. Änderungsvorschläge sind herzlich willkommen.
Die Falle der „Viking-Romantik“
Die „germanische Mythologie“ weckt heutzutage oft Bilder von Göttern wie Odin und Thor, von heldenhaften Wikingern und mystischen Runen. Diese populären Vorstellungen sind ein erster Ankerpunkt, doch wer das moderne Heidentum verstehen will, muss tiefer blicken. Denn die Geschichte der germanischen Religionen ist eine Geschichte der Vielfalt und der Fragmente.
Wenn heute von den „Germanen“ oder von der „nordischen Mythologie“ gesprochen wird, entsteht oft das Bild eines einheitlichen Volkes mit einem gemeinsamen Glaubenssystem. Doch diese Vorstellung ist eine moderne Vereinfachung, die der historischen Wirklichkeit kaum entspricht. Tatsächlich war das, was wir rückblickend als „germanisch“ bezeichnen, ein weit verzweigtes Geflecht aus Stämmen, Sprachen und religiösen Vorstellungen, das sich über Jahrhunderte hinweg wandelte.

Um die vorchristlichen Traditionen Europas besser zu verstehen, müssen wir uns von der Idee eines einheitlichen Germanentums lösen und stattdessen die Vielfalt dieser Kulturen als Teil eines größeren, dynamischen Mosaiks betrachten.
Unsere heutige Rekonstruktion religiöser Vorstellungen dieser Stämme basiert im Wesentlichen auf 4 Gruppen von Quellen:
- historische Texte
- archäologische Funde
- sprachlich-philologischen Zeugnisse
- gesammelter Volksglauben und Sagen
Zusätzlich sind die heute populären Vorstellungen der „germanischen Mythologie“ oft von der sogenannten „Viking-Romantik“ geprägt: Einer idealisierten und stark vereinfachten Sichtweise auf die skandinavische Wikingerkultur. Diese romantische Brille ignoriert jedoch die Vielfalt germanischer Religionen und ist zudem belastet durch die politische Instrumentalisierung dieser Bilder im 19. und frühen 20. Jhd. Ein seriöser Blick auf die germanischen Religionen erfordert daher die konsequente Entkopplung von vereinfachenden Action-Klischees. Außerdem betont das moderne Heidentum eine unmissverständliche und harte Abgrenzung zu politischen Ideologien.
Der Begriff „Germanen“: Eine römische Konstruktion
Erstmals berichtete der griechische Reisende Pytheas um 330 v. Chr. über die Länder um die Nordsee und die dort lebenden Völker. Doch der Begriff „Germanen“ war in der Antike kein Eigenname, sondern eine Fremdbezeichnung, geprägt von römischen Autoren. Julius Cäsar verwendete ihn in seinem Werk De Bello Gallico, um die Völker östlich des Rheins und nördlich der Donau zusammenzufassen, ohne ihre tatsächliche kulturelle Verschiedenheit zu berücksichtigen. Für ihn war „Germanien“ in erster Linie ein geographischer und politischer Raum. Moderne Forschungen wie von Heinrich Beck et al. (2008) sprechen von über fünfhundert Stämmen, die ursprünglich in Nord- und Mitteleuropa siedelten und sich während der Völkerwanderung bis an die Schwarzmeerküste ausdehnten. Sie unterschieden sich in Sprache, Kultur und Religion.
Zeitlich erstreckt sich der Begriff über Jahrhunderte hinweg: Von der vorrömischen Eisenzeit bis in die Spätantike. Die Wikingerzeit steht zwar sprachlich und kulturell in der nordgermanischen Tradition, gilt jedoch bereits als eigenständige Epoche mit spezifisch skandinavischer Identität.
Einige historische Hauptquellen hierzu haben wir am Ende des Textes aufgeführt. (A)
Nordische und kontinentale Überlieferung: Ein Mosaik aus Fragmenten
Unser Wissen über diese Stämme stammt aus einer begrenzten Zahl antiker und mittelalterlicher Quellen. Römische und griechische Autoren wie Cäsar, Tacitus, Ptolemaios und Jordanes beschrieben die germanischen Völker mit dem Blick des Außenstehenden und interpretierten deren Bräuche häufig im eigenen kulturellen Kontext. Hinzu kommen archäologische Funde – Kultplätze, Mooropfer, Runeninschriften – sowie sprachliche Zeugnisse und Reste mündlicher Überlieferung. All diese Quellen sind fragmentarisch, oft voneinander unabhängig und zeitlich weit auseinanderliegend. Ein zusammenhängendes Bild ergibt sich daraus nicht, sondern eher eine Vielzahl von Mosaiksteinen, die nur vorsichtig zusammengesetzt werden können.
Nordische Mythologie: Edda und Saga
Die bekannten Götternamen wie Odin, Thor oder Freyja stammen vornehmlich aus dem nordischen und nicht unbedingt aus dem gesamten germanischen Raum. Was heute als „germanische Mythologie“ bezeichnet wird, ist eher die nordische Überlieferung, die in den „Ländern der Nordsee“ wie Südskandinavien, Dänemark und Island bis ins Hochmittelalter hinein überliefert und schließlich schriftlich festgehalten wurde. Die Lieder-Edda und die Prosa-Edda aus dem 13. Jahrhundert bieten eine beeindruckende Sammlung mythischer Stoffe, doch sie entstanden lange nach der Christianisierung.
Einige historische Hauptquellen hierzu haben wir am Ende des Textes aufgeführt. (B)
Süd- / kontinentalgermanische Mythologie: Opfergaben und Zaubersprüche
Auf dem europäischen Festland zeigt sich die Quellenlage deutlich bruchstückhafter und von einer geschlossenen „kontinentalgermanischen Mythologie“ kann keine Rede sein. Zu den Südgermanen zählen allgemein: Langobarden, Alemannen, Bajuwaren, Thüringer, Franken, Sachsen und Friesen. Heutige Gebietsbezeichnungen sind Schweiz, Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Nordostfrankreich und Beneluxländer. Überliefert sind nur einzelne Fragmente die zwar Einblicke in religiöse Praktiken geben, doch keine zusammenhängende Göttergeschichten erzählen. Zumindest belegen einige diese Quellen, dass mythologische Elemente (wie Gottheiten analog zu Odin und Thor) auch außerhalb des nordischen Raums präsent waren. Unsere heutige Rekonstruktion religiöser Vorstellungen dieser Stämme basiert im Wesentlichen auf:
- Historische Texte: Die Germania des Tacitus (stark orientiert an der römischen Mythologie), antike Rechtstexte und mittelalterliche Missionsberichte.
- Archäologische Funde: Kult- und Opferplätze (z. B. Thorsberger Moor, Opfermoor Niederdorla), Runeninschriften und Bildsteine.
- Schriftliche Quellen: Die Merseburger Zaubersprüche, das altsächsische Taufgelöbnis und die mythologischen Versatzstücke aus dem angelsächsischen Nine Herbs Charm.
Einige historische Hauptquellen hierzu haben wir am Ende des Textes aufgeführt. (C)
Fazit: Germanische Religionen im Plural
Die Vorstellung einer „germanischen Mythologie“ ist recht modern. In der heutigen Forschung spricht man daher zunehmend von „germanischen Religionen“ im Plural. Der religiöse Raum der germanischen Welt war von Wandel und regionaler Vielfalt bestimmt – ein Netzwerk von Kulten, Bräuchen und Symbolen, das nie ein festes, dogmatisches System bildete. Mit dem Beginn des Frühmittelalters veränderte sich die religiöse Landschaft Europas und die Ausbreitung des Christentums verdrängte viele ältere Kulte, während andere in den Volksglauben übergingen. Kirchliche Quellen berichten von der Verbannung „heidnischer“ Rituale, zugleich bezeugen sie, dass diese Praktiken noch lange fortbestanden. Manche Vorstellungen lebten weiter in späteren Heldensagen oder in christlich überformten regionalen Bräuchen. So verschmolzen Altes und Neues zu einem kulturellen Mix, in dem Spuren des Heidentums bis weit in die Neuzeit reichen.
Gelebte nordische Spiritualität heute: Asatru und das moderne Heidentum

Das Valknut Symbol
Wenn man all diese Entwicklungen betrachtet wird deutlich: „Die germanische Mythologie“ im Singular hat es nie gegeben. Stattdessen begegnen wir einer Vielzahl regionaler Religionen, die sich über Jahrhunderte verändert und gegenseitig beeinflusst haben. Was uns heute bleibt, sind Fragmente – Namen, Symbole, Lieder und archäologische Spuren – aus denen sich kein geschlossenes Glaubenssystem rekonstruieren lässt, wohl aber ein lebendiges Bild religiöser Vielfalt.
Das moderne Heidentum, wie z.B. das Asatru, knüpft bewusst an diese Vielfalt der germanischen Stämme und ihrer Überlieferungen an. Es versucht nicht, eine verlorene Vergangenheit zu imitieren, sondern versteht die alten Überlieferungen als Inspiration für eine zeitgemäße, respektvolle Spiritualität, die historische Quellen mit moderner Erfahrung verbindet. Auch im deutschsprachigen Raum, etwa im Eldaring e.V., wird Asatru als spirituelle Praxis gepflegt, die Naturverbundenheit und ethische Grundsätze wie, z.B. Mut, Gastfreundschaft und Treue, betont.
In dieser Haltung zeigt sich vielleicht der eigentliche Kern der alten Religionen: die Anerkennung der Natur, der Ahnen und der unzähligen Formen des Göttlichen, die die Welt durchdringen. Was einst viele kleine Kulte verband war kein Dogma – es war eine Haltung der Verbundenheit. Und gerade darin liegt ihre bleibende Faszination.
Das heutige Heidentum ist ein offenes Glaubenssystem, das jede Form von Diskriminierung ablehnt und von Achtung vor allen Menschen und der Anerkennung der kulturellen Vielfalt geprägt ist. Wer heute Odin, Freyja oder Tyr verehrt, tut dies in einem Kontext, der sowohl auf Überlieferung als auch auf individueller spiritueller Praxis beruht.
Beispiele für spirituelle Elemente, Symbole und Gottheiten
- Naturverehrung: Eine tiefe Verbindung zur Natur. Kräfte und die Elemente der Natur wurden als göttlich oder als von Göttern beeinflusst betrachtet.
- Yggdrasil und die neun Welten: Der Weltenbaum bildet die Struktur des Universums und verbindet alle neun Welten. Am Fuße von Yggdrasil leben die drei Nornen. Schicksalsgöttinnen die das Schicksal aller Lebewesen durch das Weben von Fäden bestimmen.
- Schamanismus/Seiðr: Praktizierende wie die Seher oder Völvas fungierten als Mittler zu den Göttern und nutzten ihre Fähigkeiten für Rituale, Weissagungen und magische Handlungen.
- Ahnenkult: Der Kult der Disir
- Runen: Eine Form der magischen und spirituellen Schrift. Jede Rune hat eine eigene Bedeutung und Kraft, wie die Rune Ansuz, die mit Weisheit und Odin verbunden ist.
- Valknut: Ein Symbol aus drei ineinander verschlungene Dreiecken und die Verbindung zwischen Erde, Himmel und Unterwelt symbolisieren kann.
- Magische Gegenstände: Artefakte wie Thors Hammer Mjölnir oder Odins Speer Gungnir gelten als mächtige Symbole der göttlichen Macht.
- Götterglaube: Liste einiger Namen von Gottheiten der verschiednenen germanischen Kulturen
Nordgermanische (Nordische) Gottheiten und Wesen (Asen, Wanen, Jötunn): Odin, Thor, Tyr, Frigg, Freyja, Balder, Bragi, Heimdallr (Ríg), Höðr, Víðarr, Váli, Ullr, Hœnir, Iðunn, Nanna, Sif, Skaði, Snotra, Syn, Gefjon, Hlín, Lofn, Jörð, Njörðr, Freyr, Loki, Ymir, Surt, Hel, Ægir, Mímir, Buri, Börr, Dag, Delling, Lóriði, Öku-Thor, Rán, Nornen, Urd, Verdandi, Skuld
Kontinentalgermanische Gottheiten und Heroen: Wuotan, Donar, Ziu, Frīja, Phol, Folla, Balter, Thunaer, Saxnōte, Irmin, Fosite, Fricco, Hathagāt, Wurth, Gauȥ (Gapt), Ansis, Dounabis, Baduhenna, Tamfana, Alcis, Ricagambeda, Baudihillia, Burorina, Matronae, Tuisto, Mannus, Wieland (Wielant), Gungingi, Ibor, Agio, Gambara, Iring, Frau Wode (Gode), Frau Herke (Harre), Wōden, Þunor, Tīg, Seaxnēat, Ēastre, Hrēðe, Wēland, Ēarendel, Gēat, Ærta, Hengist, Horsa. Historisch nicht bezeugt: Ostara, Krodo, Cisa, Fosta, Hama, Hertha, Jecha, Lollus, Reda, Reto, Ricen, Satar, Siwa, Stuffo, Teut, Thisa.
Quellenhinweise
(A) Antike Hauptquellen für Namen und Lokalisierung germanischer Stämme
- 50 v. Chr.: Caesar: Commentarii de Bello Gallico (“Die Eroberung Galliens“)
- 98: Tacitus: Germania („Über Herkunft und Lage der Germanen“)
- 150: Ptolemaeus: Geographike Hyphegesis („Geographische Anleitung“)
- 6. Jhd.: Jordanes: De origine actibusque Getarum, kurz Getica („Von Ursprung und Taten der Goten“)
(B) Historische Hauptquellen zur nordgermanischen Literatur
Die sog.norröne Literatur (altdänisch, altschwedisch, altnorwegisch und altisländisch) enthält bekannte germanische Werke, wie die Heldensage und das Heldenlied. Diese sog. Sagas oder Isländersagas sind die einzigen schriftlich überlieferten, volkssprachlichen Erzählprosa Nordeuropas. Entstanden sind sie ab dem 11. Jhd. unter christlichem Einfluss, da Kultur und damit auch Mythologie bis dahin nur mündlich überliefert worden waren. Meist wurden diese Werke in skaldischer oder eddischer Dichtung verfasst und zählen zur sog. Sagaliteratur.
- 1270: Manuskript Codex Regius („Lieder-Edda“): Sammlung von Mythen und Heldenliedern aus dem 10. Jhd.
- 13. Jhd., Island: Snorra-Edda: Dichter und Historiker Snorri Sturluson über nordischen Mythologie.
- Island: Saga-Literatur: Eine Sammlung von Erzählungen, die mythologische Themen aufgreifen.
- ca. 1200, Dänemark Gesta Danorum (von Saxo Grammaticus,): Eine Geschichte der Dänen, die viele germanische Mythen enthält.
(C) Historische Hauptquellen zur Süd- bzw. kontinentalgermanischen Mythologie
- Vorrömische Eisenzeit (800 v. Chr.): Die Namen der Hauptgottheiten waren in der Sprache gebräuchlich. Überliefert sind sog. Pfahlgötzen in Opfermooren wie z.B. das in Oberdorla (Thüringen)
- Römische Kaiserzeit (50 v. Chr. – 450): Hauptquelle ist die Germania von Tacitus („Über Herkunft und Lage der Germanen“, Jahr 98), worin er die Hauptgottheiten mit römischen Namen benennt. Weitere Quellen sind mehrere Weihesteine mit einer Vielzahl mehr oder weniger bekannter Götternamen.
- Frühmittelalter (ab 450 bis zur Christianisierung): Nach der Völkerwanderungszeit gewannen die Franken unter den Merowingern die politische Macht über Mitteleuropa. Die alten Bräuche gingen im Rahmen der Christianisierung mehr und mehr verloren. Die wichtigsten Zeugnisse dieser Zeit sind:
- Überlieferte Texte der Langobarden, der Alemannen, der Franken und Thüringer, der Sachsen, sowie der Friesen geben Einblicke in einzelne Stammesmythen. Am bekanntesten sind wohl die Merseburger Zaubersprüche, der Pariser Segen und der angelsächsische Neunkräutersegen („Nine Herbs Charm“). Weitere Werke und Autoren sind Paulus Diaconus, Origo Gentis Langobardorum, Edictus Rothari, Vita Columbani Abrenuntiatio Sax., Widukind von Corvey, Rudolf von Fulda, Vita Willibrordi.
- Mittelalterliche Missionsberichte und kirchliche Verbots- und Bußschriften wie das altsächsische Taufgelöbnis, das Christenrecht in der Gulathingslov und das Indiculius über heidnischen Aberglauben aus dem 8. Jhd. Runeninschriften u.a. aus Nordendorf, Pforzen, Balingen und Schretzheim.
- Hochmittelalter und frühe Neuzeit: Verdecktes Weiterleben einiger Gottheiten im Volksglauben, wie zum Beispiel die Numina oder die Donarverehrung. Auch modernere Heldenepen wie das Hildebrandslied, das Kudrunlied oder das Nibelungenlied geben einige Anhaltspunkte.
- Neuzeit (ab ca. 18. Jhd.): Verschiedene Gruppierungen des Neopaganismus bzw. Germanisches Neuheidentums versuchen, einige der alten Bräuche wiederzubeleben
Zeitgenössische Literatur zur germanischen Mythologie und Religionsgeschichte (Beispiele)
Lexika und Standardwerke
- Beck, Heinrich (Hrsg.) (1973–2008): Reallexikon der Germanischen Altertumskunde (2. Aufl., 37 Bde.). Berlin: De Gruyter. ISBN 978-3-11-019146-2, S. 20 ff.; PDF (500 kB). Umfassendes Werk zur germanischen Kultur, Religion, Archäologie und Geschichte.
- Simek, Rudolf (2006,2013,2021): Lexikon der germanischen Mythologie. überarb. Aufl. Stuttgart: Kröner. Wissenschaftlich fundiertes Nachschlagewerk zu Göttern, Mythen, Orten und Quellen.
Überblicks- und Einführungswerke
- de Vries, Jan (1956–1957): Altgermanische Religionsgeschichte. 2 Bde. 2. Aufl. Berlin: De Gruyter. Überholt, aber historisch bedeutend.
- Lindquist, Ivar (1973): Germanische Religion und Glaubenswelt. Köln: Diederichs.
- Polomé, Edgar C. (ed.) (1992): Essays on Germanic Religion. Washington: Journal of Indo-European Studies Monograph Series. Sammlung von Fachartikeln aus sprachlicher und historischer Perspektive.
- Mischa Meier (2000): Caesar hat die Germanen erfunden – oder doch nicht? In: Martin Langebach (Hrsg.): Germanenideologie. Einer völkischen Weltanschauung auf der Spur. Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2020.
Quelleneditionen und -übersetzungen
- Die Edda. Die Götterlieder der älteren Edda. Hrsg. u. übers. von Felix Genzmer. Stuttgart: Kröner (mehrere Ausgaben).
- Snorri Sturluson: Prosa-Edda. Übers. von Anthony Faulkes, mit versch. dt. Ausgaben.
- Tacitus: Germania. Verschiedene kritische Ausgaben und Übersetzungen (z. B. von Manfred Fuhrmann).
- Jordanes: Getica. Übers. von Theodor Mommsen (in den „Monumenta Germaniae Historica“).
Regionale / thematische Studien
- Neumann, Peter (1982): Germanische Heilkunde und Zauberei. Stuttgart: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Brink, Stefan & Price, Neil (Hrsg.) (2008): The Viking World. London: Routledge.
- Raudvere, Catharina (2003): Paganism – The Recurring Past. In: Nordisk Hedendom, Lund.
- Puhvel, Jaan (1987): Comparative Mythology. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Merseburger Domstift: Die Merseburger Zaubersprüche, https://www.merseburger-dom.de/die-merseburger-zaubersprueche-auf-dem-weg-zum-unesco-weltdokumentenerbe/, abgerufen am 3. Oktober 2025.